Umrüsten statt neu kaufen – so fahren Dieselbusse künftig elektrisch
Dieselfahrzeuge haben einen schlechten Ruf, deshalb sind mehr und mehr Elektrobusse gefragt. Eine ganze Busflotte auszutauschen, wäre jedoch teuer. Günstiger ist es, die Fahrzeuge auf Elektroantrieb umzurüsten: mit dem Umrüstkit e-troFit.
Anbieter zum Thema

Die Debatte über Dieselfahrverbote stellt viele Kommunen vor neue Herausforderungen: Was passiert mit den Dieselbussen im öffentlichen Nahverkehr? Steigende Emissionswerte in den Innenstädten setzen die Betreiber unter Zugzwang: Die Dieselbusse müssen raus aus der Stadt. Viele Kommunen suchen daher den Einstieg in die Elektromobilität. Bestehende Busflotten komplett gegen neue Elektrofahrzeuge auszutauschen ist jedoch weder wirtschaftlich noch nachhaltig – ein neuer Elektrobus ist erheblich teurer als ein konventioneller Dieselbus. Zudem sind Neufahrzeuge derzeit auf dem Markt nur in geringen Stückzahlen verfügbar.
Nachrüstung ist die smarte und nachhaltige Alternative zum Neukauf. Als Spezialist für Fahrzeugentwicklung und Systemintegration hat in-tech hierfür ein Konzept entwickelt. Die Business Unit „New Mobility Solutions“ entwickelt unter dem Namen e-troFit ein professionelles Umrüstkit für Niederflurbusse.
Eine solche Umrüstlösung ist bis zu 50% günstiger als ein Neufahrzeug. Neben den niedrigeren Anschaffungskosten hat eine Umrüstung auch noch weitere positive Aspekte, denn die Lebensdauer bestehender Fahrzeuge verlängert sich. Verschleißanfällige Antriebskomponenten werden im Rahmen der Umrüstung ersetzt, und dank der Aufbereitung und Modernisierung des Fahrgastraumes wird ein nachhaltiger „Second-Use“ des Fahrzeugs als Elektrobus möglich.
Deutscher Mobilitätspreis für e-troFit
Mit e-troFit gehört in-tech zu den zehn Preisträgern des Deutschen Mobilitätspreises, der in diesem Jahr zum dritten Mal ausgerufen wurde. Im Rahmen des Wettbewerbs prämierten die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur am 13. November wegweisende Best-Practice-Projekte zum Schwerpunktthema Nachhaltigkeit. Eine hochkarätig besetzte Expertenjury unter dem Vorsitz von Steffen Bilger, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, wählte die Preisträgerprojekte aus.
Das e-troFit Konzept
Die generelle Idee hinter e-troFit besteht darin, Nutzfahrzeuge mithilfe eines mechanisch und elektrisch kompatiblen Antriebstranges nachträglich zu elektrifizieren. Dieser Ansatz adressiert zum einen die anhaltende knappe Marktverfügbarkeit elektrischer Nutzfahrzeuge. Zum anderen wirkt die Umrüstung auch positiv auf ökologische und ökonomische Faktoren: Durch die Entfernung eines dieselgetriebenen Nutzfahrzeugs aus der globalen Ökobilanz entsteht ein größerer Vorteil im Vergleich zur Anschaffung eines elektrischen Neufahrzeugs.
e-troFit bildet dabei nicht nur die Umrüstung von Fahrzeugen ab, sondern ist als ganzheitlicher Ansatz gedacht: Startpunkt bildet eine Begutachtung der Ausgangslage. Basierend auf den Strecken die gefahren werden sollen, Anzahl an Haltestellen, Dauer der Umläufe und der Streckentopologie wird ein Fahrzeugkonzept erstellt, dass diese Anforderungen möglichst kostenoptimal abbildet. Somit wird z.B. nur so viel Batteriekapazität installiert wie notwendig.
Elektrischer Antriebsstrang
Der neue Antriebsstrang im e-troFit-Konzept ist als vollständige Substitution des alten Antriebs konzipiert. Alle Funktionen werden somit von ihren neuen elektrischen Pendants übernommen. Da durch das Bestandsfahrzeug Schnittstellen sowie Anforderungen bereits definiert sind, muss durch einen modularen Ansatz sichergestellt werden, dass Inkompatibilitäten vermieden werden, bzw. durch die Parametrierbarkeit von Komponenten Kompatibilität hergestellt werden kann. Nach der Entfernung des Dieselmotors und dessen Getriebe und Abgasanlage werden ebenso die Nebenaggregate wie Klimaanlage, Luftkompressor, Pumpen und Kühler ausgebaut. Je nach Fahrzeugtyp werden anschließend der Energiespeicher, Antrieb und elektrische Nebenaggregate integriert.
Beim Antrieb wird je nach Fahrzeugtyp eine elektrische niederflurige Portalachse von ZF (AVE130) verwendet. In dieser sind die Motoren bereits integriert. Die mechanischen Anbindungspunkte sind aufgrund des gewählten Typs bereits zu einem Großteil der in europäischen Stadtbussen eingesetzten Achsen (i.d.R. bereits von ZF) kompatibel.
Batterieintegration mittels modularem Ansatz
Aufwände entstehen insbesondere bei der Integration des Energiespeichers in das bestehende Fahrzeug-Package (Motorraum und optional auf dem Fahrzeugdach). Erzeugte Bauräume durch das Entfernen des alten Antriebstrangs werden analysiert und neue Komponenten optimal platziert. Ein modularer Ansatz erlaubt es, die Batteriekapazität in diskreten Schritten zu skalieren – zum einen entsprechend der bauraumtechnischen Gegebenheiten, aber auch entsprechend der Kundenanforderungen an Reichweite und Leistung.
Ermöglicht wird dies über eine BMS-Topologie sowie einen Leistungsverteiler, der zum einen die Batteriesystemblöcke zusammenführt und das übergeordnete Management übernimmt, zum anderen durch entsprechende steuerbare Leistungsausgänge, über die die Verbraucher versorgt werden. Sollen größere Batteriekapazitäten installiert werden ist es bei Stadtbussen notwendig Teile der Batterie auf dem Dach des Fahrzeugs zu platzieren.
Intelligentes Thermomanagement
Neben dem Antrieb selbst ist im Falle von Stadtbussen das Fahrgast-Thermomanagement ein weiterer wichtiger Verbraucher. Der hier ebenfalls modulare Ansatz erlaubt sowohl die Integration eines hybriden Zuheizers, einer Wärmepumpe, aber auch eine Kombination aus den Systemen. Eine optimale Steuerung, die das Zusammenspiel dieser Komponenten übernimmt garantiert einen, in Abhängigkeit vom Betriebspunkt, möglichst energieeffizienten Betrieb.
Hierbei müssen sowohl Parameter wie die Außentemperatur berücksichtigt werden, aber auch die Innenraumtemperatur. Die Temperaturregelung soll dabei nicht mehr auf eine feste Zieltemperatur für den Innenraum regeln, sondern sich mittels eines modellbasierten Ansatzes am Fahrgastkomfort orientieren. Hierfür erfolgen derzeit die Entwicklung und Implementierung eines anthropometrischen Komfort-Modells. Daraus leitet sich dann die neue Zieltemperatur für den Innenraum ab, die sich einerseits aus der Komfortkennzahl und dem Ziel der Energieeinsparung ergibt. Der Fahrer hat nach wie vor die Möglichkeit, seine Wunschtemperatur am Arbeitsplatz selbst zu bestimmen.
Zur finalen Optimierung zählt aber auch eine bedarfsgerechte Ansteuerung von Pumpen und des Luftkompressors. Dies stellt insbesondere bei der Nachrüstung eine größere Herausforderung dar, weil Verbraucher (z.B. Servolenkung) bisher nicht auf bedarfsgerechte Ansteuerung ausgelegt sind. Die Sensierung und die Dynamik des Systems spielen hier eine entscheidende Rolle.
Cloud-Diagnose und Modernisierung
Durch eine zum Kit gehörige Telematik-Einheit wird die Diagnose des Fahrzeugs aus der Cloud heraus ermöglicht. Weitere Bestandteile die zu einem modernen “Look und Feel” des Fahrzeuges beitragen sind z.B. Bi-LED Scheinwerfer sowie das dazugehörige Tagfahrlicht mit LED-Blinkern. Dies erhöht zum einen die Sicherheit im Straßenverkehr und steigert zudem die Arbeitsplatzqualität für den Fahrer, durch ermüdungsfreieres Fahren bei Nacht durch größere Sichtweite und Helligkeit.
Reparaturen am Grundfahrzeug sowie Modifikationen am Rahmen um das Batteriegewicht zu tragen sind im Zuge der Umrüstung ebenso möglich bzw. notwendig. Darüber hinaus kann der Innenraum in mehreren Stufen wieder auf einen modernen und neuwertigeren Stand gebracht werden. Gesteigerter Fahrgastkomfort durch USB-Anschlüsse zum Nachladen von Handys, Free WiFi bis hin zu einem OnBoard-Entertainment-System auf WLAN-Basis sind möglich.
Hochvoltsysteme im Bordnetz
Durch den Einsatz von Hochvoltsystemen (HV) im Antrieb kommen auch neue Herausforderungen auf das Bordnetz zu. Zur Sicherstellung von Leib und Leben darf die sogenannte Berührspannung zwischen zwei leitfähigen Gehäusen von 60V nicht überschritten werden (BGV, ArbSchG, VDE). So wird gewährleistet, dass bei Berührung durch Mensch oder Tier keine Lebensgefahr besteht.
Dafür werden im HV-Bordnetz neben den HV-Zuleitungen mit Isolationsüberwachung Potentialausgleichsleiter benötigt. Sie verbinden jeweils die Komponentengehäuse mit der Fahrzeugmasse. Zur Reduzierung von Kosten und Gewicht bei maximaler Sicherheit, werden Modelle zur Berechnung der Temperaturerhöhung im Kurzschlussfall verwendet, genauso wird die Belastbarkeit der Leitung mit der Auslösecharakteristik des Sicherungssystem verglichen. Zum Schluss muss der Spannungsabfall über den gesamten Potentialausgleichspfad errechnet werden, der nicht größer als 60 V sein darf. Diese Modelle können auf die HV-Leitungen übertragen werden, um diese ebenso optimal auslegen zu können.
Entwicklung des E/E-Systems
Das e-troFit-Kit wurde bereits nach der neuen ISO 26262 entwickelt, die nun auch Fahrzeuge über 3,5 t zul. Fahrzeuggewicht einschließt. Herausforderung insbesondere bei der Nachrüstung von Antriebsträngen ist, die funktionale Sicherheit gewährleisten zu können, ohne das bestehende Bordnetz zu kompromittieren bzw. Fehler zu erzeugen. Herzstück der elektrischen Systemintegration stellt daher eine von in-tech entwickelte Fahrzeugsteuerung dar, die den fehlerfreien und zuverlässigen Betrieb des Fahrzeuges sicherstellt.
Eine der Hauptherausforderungen beim Retrofitting eines Nutzfahrzeuges ist die Verbindung der im Fahrzeug verbleibenden Bauteile mit den neuen Komponenten. Da durch den Entfall des Dieselaggregates die damit verbundenen Nebenaggregate entfallen, müssen diese durch elektrische Komponenten ersetzt werden. Dabei muss, abhängig von deren Funktion, neben den funktionalen Aspekten auch das Thema Funktionale Sicherheit betrachtet werden.
Aus diesem Grund wird in einem ersten Schritt das bestehende System analysiert, um die Abhängigkeiten und Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten detailliert zu ermitteln. Das passiert durch Analyse der Schaltpläne, der Fahrzeugdokumentation und der Kommunikationsschnittstellen (CAN-Bus) sowie durch die Vermessung des Bauraums im Fahrzeug.
Erst nachdem alle Anforderungen an die jeweiligen Komponenten ermittelt wurden, wird mit der Suche nach dem richtigen Ersatz begonnen. Dabei erfolgt die Auswahl dieser neuen Komponenten nicht nur entsprechend der identifizierten Funktionalität, sondern auch entsprechend der für Elektro- und Nutzfahrzeuge gültigen Normen und Standards.
Für alle neu entwickelten Funktionen des E/E-Systems kommt die nun auf Trucks und Busse erweiterte ISO 26262 zur Anwendung, um die Funktionale Sicherheit im elektrischen Antriebsstrang sicherzustellen. Eine besondere Herausforderung ist die Analyse aller von Modifikationen betroffenen bestehenden Funktionen im Fahrzeug. Abhängig vom Ergebnis der Analyse müssen auch für diese Funktionalitäten Safety-Aktivitäten eingeplant werden.
Um die durch die Gültigkeit der ISO 26262 zusätzlichen Anforderungen an den Entwicklungsprozess effizienter umsetzen zu können, werden sowohl Anforderungsmanagement als auch Modellierung in einem zentralen Tool durchgeführt. Dies ermöglicht es auf einfache Weise, Anforderungen mit dem Design zu verbinden und so die von der ISO geforderte Traceability zu erfüllen. Dafür wurde ein spezialisiertes und auf die Anforderungen der ISO 26262 abgestimmtes UML Profil entworfen.
Gefahren- und Risikoanalyse
Zu Beginn der Entwicklung wurde gemeinsam mit den Zulieferern der Hauptkomponenten eine Gefahren- und Risikoanalyse durchgeführt. Die dabei identifizierten Sicherheitsziele mit zugehöriger ASIL Einstufung dienten als Ausgangspunkt für die Ableitung der Sicherheitsanforderungen. Die so gewonnenen Sicherheitsanforderungen bilden gemeinsam mit den funktionalen Anforderungen die Basis für die Auswahl der Komponenten des Systems.
Das zentrale Element der Entwicklung stellt das Fahrzeugsteuergerät dar. Einerseits versorgt es die bestehenden Komponenten mit allen Informationen, welche zum fehlerfreien Betrieb benötigt werden, andererseits werden die Anforderungen an die Integration der neuen Komponenten zum größten Teil durch das Fahrzeugsteuergerät umgesetzt. So müssen etwa die neuen elektrisch betriebenen Nebenaggregate gesteuert und neue Steuergeräte mit den relevanten Informationen über die CAN-Schnittstelle versorgt werden. Das Fahrzeugsteuergerät stellt also das Bindeglied zwischen verbleibenden und neuen Bestandteilen des Fahrzeugs dar.
Im gesamten Fahrzeug wird ein besonderes Augenmerk auf die effiziente Energienutzung gelegt.
Die Verwendung von elektrisch betriebenen Nebenaggregaten bietet dabei etliche Möglichkeiten. So wird etwa der Luftkompressor in konventionellen Fahrzeugen durch eine direkte Verbindung mit dem Motor permanent angetrieben, während eine elektrische Variante eine bedarfsorientierte Steuerung ermöglicht. Das gilt auch für eine Reihe weiterer Nebenaggregate.
Ladekonzept und Ladeinfrastruktur
Neben der Modifikation bestehender Fahrzeugfunktionen müssen auch gänzlich neue Fahrzeugfunktionen implementiert werden. In diese Kategorie fällt die Umsetzung der Ladefunktion. Das bi-direktionale Laden wird im Wesentlichen durch das Batteriemanagement System und das Ladegerät umgesetzt. Damit beide Steuergeräte beim Laden aber auch bei ausgeschalteter Zündung zur Verfügung stehen, muss ein wesentlicher Teil der Klemmensteuerung durch das Fahrzeugsteuergerät übernommen werden. Die Fahrzeugsteuerung wird beim Laden durch den Ladecontroller aufgeweckt und muss anschließende alle am Ladevorgang beteiligten Systeme einschalten bzw. wecken. Da häufig auch die Konditionierung des Fahrgastraumes während des Ladens durchgeführt wird, gehört unter anderem auch das Heiz- und Kühlsystem dazu.
Das Ladekonzept ist eng verknüpft mit der Frage nach der Ladeinfrastruktur. Das Lademanagement spielt hier zukünftig eine wichtige Rolle. Gerade bei Nachtladekonzepten, wenn eine große Anzahl an Fahrzeugen nachts über geladen werden müssen, kann die Anschlussleistung des Standortes das limitierende Kriterium sein. An dieser Stelle kann ein Backend welches Ladepläne basierend auf den Ausrückzeiten bereitstellt ein wichtiger Schritt zur Umsetzung sein. Der Controller im Fahrzeug wird daher als Dualmode-Controller entwickelt, der sowohl den Standard DIN 70121 sowie den Standard ISO 15118 beherrschen wird. Letzterer ermöglicht die Umsetzung eines Lademanagements.
Verfügbarkeit und Zulassung
Das erste e-troFit-Kit wird ab 2019 auf dem Markt erhältlich sein. Im weltweiten Werkstattnetz des Partners ZF können Fahrzeuge mit dem Kit nachgerüstet werden. Die Zulassung der Fahrzeuge erfolgt in jedem Fall im Rahmen einer Einzelabnahme auf Basis eines Musterprüfberichts und stellt somit einen unkomplizierten und kostengünstigen Weg dar.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1375200/1375213/original.jpg)
Mini Classic Electric – Alteisen als Zukunftsbote
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1291500/1291518/original.jpg)
Gelungener Umbau
Ausgebranntes Wrack wird zum ersten und einzigen Elektro-Ferrari
* Matthias Kerler ist Head of Domain bei der in-tech GmbH in Garching bei München.
* * Florian Hetzendorfer ist Projectmanager Automotive bei der in-tech GmbH.
* * Laura Wehner ist Test- und Entwicklungsingenieur bei der in-tech GmbH in Garching bei München.
Artikelfiles und Artikellinks
Link: Zu in-tech
(ID:45638431)



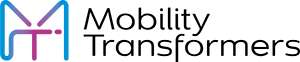
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ca/a3/caa37eede193f8bdb07874630439cb1b/0129344206v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/de/7e/de7e6c30ae3fdb02c5f21a0d82dd83e1/0129332110v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/eb/2a/eb2ae52fed872f72945a82e20102a44f/0129267589v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/7c/237cae1e646212a6506b57a39f63fdfc/0129206638v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/37/ec/37ec252fae2b92c42d9e9ab43a5d166c/0129333782v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/45/14456d258fce7735203a31ac24e17e84/0129325747v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/77/00/7700bd2a561c6ce21b036ebc8dbc5362/0129309954v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/58/4a/584a031cfbf34053401421566f8c30b5/0129264874v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/0c/4d0c72f38b836539af66d2efcdaee1ac/0129309231v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/df/72/df72214a59dcab1167187c1dc50ecca2/0129233467v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/1d/031dfeb087371f6707f30b46b355e4c0/0129205858v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/68/c368a3ad72ac970809451c311e05a07b/0127817359v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/4f/6a4f63cfca5e01026d25edd19b5302c5/0127761368v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/42/86/4286fd057b5413102fbac1758d2dc55f/0127713923v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/49/36496a26b0c295de6d9a36d66ea7571a/0125402418v3.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1494300/1494389/original.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1494300/1494390/original.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1494400/1494448/original.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1494300/1494392/original.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/78/b5/78b5f0d865ec25b3a4b8eed6bf069d0d/0126563387v4.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/95/99/9599a65f13cda2a9cb0ef29687ec3941/0123215559v2.jpeg)