Offene Standards ermöglichen eine einfache Integration der Ladestation
Wer in der häuslichen Garage für sein Elektrofahrzeug eine Ladestation installiert, sollte diese in die Gebäudesteuerung integrieren. Bei der Integration spielen offene Standards eine wichtige Rolle.
Anbieter zum Thema

Gründe für die Integration gibt es genug. Zum einen geht es um den Komfort – der Fahrer möchte den Ladestatus bequem vom Wohnzimmer aus einsehen können. Bei einem eventuellen Ladefehler möchte er nicht erst am nächsten Morgen feststellen müssen, dass sein Fahrzeug gar nicht geladen ist. Auch wirtschaftliche und ökologische Gründe sprechen für die Integration. Betreibt der E-Mobilist zudem eine PV-Anlage, wird er stets nach Wegen suchen, den Eigenverbrauch seines Solarstroms zu erhöhen.
Bedarfsgerechte Energieverteilung
Ein Elektrofahrzeug mit einer Jahresfahrleistung von 15.000 bis 20.000 km hat einen Energiebedarf von circa 3000 kWh – das entspricht dem Verbrauch eines durchschnittlichen Vierpersonenhaushalts. Damit wird das Elektrofahrzeug zu einem potenziellen Verbraucher, der einen Großteil des (Solar-)Stroms abnehmen kann. Bei mehreren Ladestationen ergibt sich schon allein durch die verfügbare Netzanschlussleistung häufig die Notwendigkeit, die Ladung der Fahrzeuge zu steuern und mit anderen Großverbrauchern zu koordinieren. So kann es etwa in einem Hotel erforderlich sein, kurzfristig die Ladeleistung für die Elektrofahrzeuge der Gäste zu reduzieren oder die Ladung sogar ganz auszusetzen – etwa wenn in der Küche Hochbetrieb herrscht und alle elektrischen Geräte im Einsatz sind. Ungesteuertes Laden würde hier den Netzanschluss schnell überlasten.
Durch eine intelligente Integration erübrigt es sich, den Netzanschluss größer zu dimensionieren oder nachzurüsten – was häufig ein schwieriges und teures Unterfangen ist. Auf der anderen Seite kann der überschüssige Strom eines oftmals vorhandenen w+ärmegeführten Blockheizkraftwerks sinnvoll zur Fahrzeugladung genutzt werden – anstatt ihn in das Netz einzuspeisen.
Einfache Integration in das Smart Home-System
Im Bereich der Gebäudeautomation hält der Markt zahlreiche – proprietäre und offene – Lösungen bereit. Die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Ladestation ist genormt: in der IEC 61851-1 Annex A ist festgelegt, wie der Ladevorgang im sogenannten Lademodus 3 seitens der Ladestation gestartet und wieder unterbrochen wird. Geregelt ist dort auch der maximale Ladestrom aus dem Netz. Hierzu ist in der Ladestation typischerweise eine sogenannte Mode-3-Ladesteuerung verbaut – etwa die EV CC Basic oder die EV CC Advanced von Phoenix Contact. Die Steuerung übernimmt die Signalisierung zum Fahrzeug sowie das Zuschalten der Netzspannung.
Derartige Ladesteuerungen verfügen über standardisierte Kommunikationsschnittstellen mit offengelegten Kommunikationsparametern (Bild 1). Bei der Ladesteuerung EV CC Basic geschieht dies über eine RS485-Schnittstelle mit dem Protokoll Modbus RTU. Die EV CC Advanced wird über Ethernet und dem Protokoll Modbus TCP angesteuert. In beiden Fällen kann ein überlagertes System die Ladefreigabe erteilen, wenn entsprechende Register gesetzt werden. Es kann aber auch ein neuer Ladestrom zum Fahrzeug vorgegeben werden. In Abstufungen von 1 A kann die Steuerung die verfügbare Leistung optimal verteilen.
Zur Anbindung an die Gebäudesteuerung gibt es zwei Möglichkeiten: die direkte Verbindung zwischen der Ladesteuerung in der Ladestation und der Gebäudesteuerung, oder die Anbindung über ein Feldbussystem wie KNX. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern hat Phoenix Contact beide Ansätze verfolgt und entsprechende Lösungen mit entwickelt.
Anbindung durch einfache Konfiguration
„Mygekko“ – das Smart Home-System der Ekon GmbH mit Sitz in Südtirol – ist ein Hersteller- und Plattformübergreifendes Regel- und Automatisierungssystem für Gebäude. Das System führt die Komponenten Heizung, Klima, Jalousien, Alarmanlage, Kamerasysteme und Solaranlage zusammen. Als weitere Komponente wurden die Ladesteuerungen von Phoenix Contact integriert (Bild 2).
Der Installateur muss hier nicht programmieren, die Anbindung erfolgt durch eine einfache Konfiguration. Für den späteren Nutzer wurde eine intuitiv bedienbare Oberfläche geschaffen. Zur Inbetriebnahme wählt der Installateur im Set-Up-Menü lediglich die verbaute Ladesteuerung aus einer Liste – und legt Parameter wie die Kommunikationsadressen fest. Damit steht schon die Verbindung zwischen der Ladestation und Mygekko. Die erforderlichen Werte – etwa die maximal verfügbare Netzleistung – werden eingegeben, und ein Zähler für die PV-Leistung wird mit angebunden.
(ID:45084711)



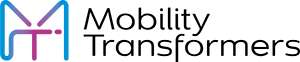
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ca/a3/caa37eede193f8bdb07874630439cb1b/0129344206v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/de/7e/de7e6c30ae3fdb02c5f21a0d82dd83e1/0129332110v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/eb/2a/eb2ae52fed872f72945a82e20102a44f/0129267589v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/7c/237cae1e646212a6506b57a39f63fdfc/0129206638v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/af/f4afeec441671291b3346a865be2acb7/0129354681v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/0e/d90e2d8e78a0a0bf2c5df2ef8eb583fe/0129353500v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/73/5d/735dc4a0e2e4acbe3623167803d31fc4/0129349252v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/37/ec/37ec252fae2b92c42d9e9ab43a5d166c/0129333782v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/45/14456d258fce7735203a31ac24e17e84/0129325747v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/0c/4d0c72f38b836539af66d2efcdaee1ac/0129309231v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/df/72/df72214a59dcab1167187c1dc50ecca2/0129233467v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/1d/031dfeb087371f6707f30b46b355e4c0/0129205858v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/68/c368a3ad72ac970809451c311e05a07b/0127817359v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/4f/6a4f63cfca5e01026d25edd19b5302c5/0127761368v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/42/86/4286fd057b5413102fbac1758d2dc55f/0127713923v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/49/36496a26b0c295de6d9a36d66ea7571a/0125402418v3.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/62/16/621651a93b1ef/logo-we-rgb-pos.png)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1340600/1340634/original.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1340600/1340635/original.jpg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1340600/1340636/original.jpg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/21/71/21712c3d5e2fb9585079d0659ded6573/0127889253v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2f/ae/2fae151f0bbe7cb280475edacb47d10e/0127358378v3.jpeg)