Schnellladesäulen – Modulares Flexbox-System berücksichtigt drei entscheidende Kriterien
Schnellladen, egal ob im Parkhaus, am Supermarkt, auf einer Autobahnraststätte – für jeden Einsatzzweck hat Porsche Engineering nun eine Lösung entwickelt: ein modulares Flexbox-System, das die gegebene Eingangsspannung, die Besucherfrequenz und die Platzverhältnisse berücksichtigt.
Anbieter zum Thema

Betrachtet man die aktuell eingesetzten Schnellladesäulen, zeigen sich sofort die Nachteile der Systeme. Bisher sind in jeder Ladesäule sämtliche fürs Laden notwendigen Komponenten installiert: Transformator, galvanische Trennung, Leistungselektronik, Kühlung und Konnektivität – ein hoher Aufwand, der jede einzelne Säule unverhältnismäßig teuer macht. Als Alternative kristallisierte sich deshalb für Porsche Engineering schnell ein Ladepark mit einer neuen Systemarchitektur und einer neuen Generation von Ladesäulen heraus.
Diese neue Gerätegeneration ist eine Schnittstelle zum Kunden und ermöglicht durch geringe Betriebskosten einen interessanten Business Case für unterschiedlichste Betreiber. Das von Porsche Engineering konzipierte Ladepark-System ermöglicht zeitgleich mehreren Elektroautos, ihre Batterien zu laden. Dank 800-Volt-Technik können sie in nur 20 Minuten genug Energie für etwa 400 Kilometer Reichweite speichern. Genug Zeit zum Beispiel für einen Pausenkaffee an der Raststätte oder die Besorgung im Supermarkt oder in der Fußgängerzone.

Flexboxen – Bausteine der Architektur
Das Ladepark-System von Porsche Engineering ist konzipiert wie ein Baukasten aus normierten, allwettertauglichen Gehäusen, den sogenannten Flexboxen. Sie ermöglichen eine flexible Bestückung mit allen notwendigen Komponenten in einem Standardraster und können weit entfernt von den Ladesäulen positioniert werden, etwa hinter einem Gebäude oder einer Hecke. Optisch und auch akustisch sind sie so für den Kunden nicht präsent. Zudem ergeben sich für geplante wie schon bestehende Gebäude beste Integrationsmöglichkeiten: Dort, wo noch Platz ist, fügen sich die Module ein, während die Säulen bestens positioniert für den Kunden bereitstehen.
Räumlich sind also keine generellen Voraussetzungen für die Einrichtung eines Ladeparks nach dem Prinzip von Porsche Engineering vorgegeben. Technisch vorteilhaft für mittlere und große Ladeparks ist, dass ein Anschluss an das Mittelspannungsnetz (36 Kilovolt Wechselstrom) möglich ist. Eine Trafostation wandelt dann diese Mittelspannung (MV) in Niedrigspannung (LV) um. Auf der Sekundärseite des Transformators steht standortunabhängig immer dieselbe niedrigere Wechselstromspannung bereit.
Der intelligente Aufbau des Transformators erlaubt zudem, die aus Sicherheitsgründen notwendige galvanische Trennung unterzubringen. Der Nutzen ist klar: Die zentrale galvanische Trennung erspart diese in den einzelnen Ladesäulen. Dort ist sie bislang Bestandteil der Leistungselektronik und treibt Platzbedarf und Kosten in die Höhe. Auch für Standorte, wo diese Voraussetzung nicht gegeben ist, steht eine Lösung in Form einer Trafobox zur Verfügung.
Hoher Wirkungsgrad – geringere Betriebskosten
Neben den geringeren Baukosten fallen auch die geringeren Betriebskosten ins Gewicht. Im Kontrollserver der Trafostation laufen sämtliche Informationen aller Steuergeräte der Hardware zusammen – vergleichbar einem lokalen Netzwerk. Das Zentralhirn prüft und verbindet etwa die Steuergeräte für die Kühleinheit, die Leistungselektronik und die Ladesäule. Der Kontrollserver übernimmt für die Abrechnung auch die Kommunikation zum Back-End des jeweiligen Betreibers. Das Ergebnis: Der Wirkungsgrad verbessert sich durch diese innovative Architektur auf über 95 Prozent, wodurch spürbar geringere Betriebskosten gegenüber bekannten Systemen möglich werden.
PowerBox
Zunächst wird die Wechselstrom-Niederspannung aus der Trafostation in der sogenannten PowerBox in Gleichstrom umgewandelt. Die PowerBox kann mit zwei Leistungselektroniken bestückt werden und versorgt damit zwei Ladepunkte. Für ihre Funktion werden Siliziumcarbid-Module der neuesten Generation verwendet. Die Vorteile sind im Vergleich zu Bausteinen auf bekannter Technologie niedrigere Leitungs- und Schaltverluste sowie geringerer Platzbedarf.
Auch können Elemente wie beispielsweise Netzfilter wegen der höheren Taktfrequenz kleiner gebaut werden. Die Komponenten sind so ausgelegt, dass sie eine Distanz zwischen Trafostation und PowerBox von bis zu 200 Metern und zwischen PowerBox und Ladesäule von bis zu 100 Metern erlauben. Daraus ergibt sich eben jene hohe Flexibilität für die Positionierung der Bauteile an jeder beliebigen Stelle. Technisch wären sogar noch größere Distanzen möglich, allerdings dann mit erhöhten Leistungsverlusten und vor allem höheren Baukosten.
CoolingBox
Ein weiterer wichtiger Baustein des Ladeparks ist die CoolingBox. Mit ihrer Hilfe werden Säulen und die Leistungselektronik flüssigkeitsgekühlt. Jede CoolingBox kann zwei Kühleinheiten enthalten, die jeweils die zuverlässige Kühlung von mehreren Ladepunkten unter allen Betriebsbedingungen garantieren. Äußerlich unterscheidet sich eine CoolingBox von den anderen Flexboxen des Ladeparksystems durch Lüftungsschlitze für Zu- und Abluft. Optimal platziert ist die CoolingBox in größerer Entfernung zu den Ladesäulen. So wird sichergestellt, dass die beim Kühlen entstehenden, unvermeidlichen Geräusche kundenfern bleiben.
ComboBox – die Alternative für kleine Ladeparks
Auch auf besondere Anforderungen der Ladeparkbetreiber, wie etwa extrem wenig Platz, kann die Porsche Engineering-Entwicklung flexibel reagieren – zum Beispiel bei kleineren Anlagen. Arbeitet ein Betreiber nur mit wenigen Ladepunkten, gibt es ein kompaktes Alternativ-System: Die sogenannte ComboBox vereint PowerBox und CoolingBox, also eine Leistungseinheit mit einer Kühleinheit, was für jeweils einen Ladepunkt ausreicht.
ChargeBox – Schnellladen auch ohne Mittelspannung
Selbst für Fälle, in denen kein ausreichend starker Netzanschluss zur Verfügung steht, bietet das modulare Ladesystem eine Lösung, mit der Elektroautos sehr schnell geladen werden können. Die hierfür speziell konzipierte ChargeBox enthält neben einer Leistungseinheit eine zusätzliche Puffer-Speicher-Batterie. Sie wird aufgeladen, solange kein Fahrzeug die Ladesäule nutzt. Durch die Speicherbatterie als Ersatz für Netzleistung steht für den Kunden aber auch hier eine hohe Ladeleistung abrufbereit. Ideal ist die ChargeBox für Standorte mit wenig Ladefrequenz pro Tag, und wenn ein Ausbau der Netzkapazität teuer ist. Die ChargeBox gibt es als Einstiegsmodell mit 70 kWh Batterie und einer 160 kW Ladesäule.
Für höher frequentierte Standorte, für Fahrzeuge mit höheren Ladeleistungen oder als spätere Nachrüstung kann man auch auf die Vollausstattung mit 140 kWh und zwei Ladesäulen à 160 kW, zusammenschaltbar auf 320 kW, zurückgreifen. Als weiteres wichtiges Element der Lösung sichert eine Smart Grid Unit am Netzanschlusspunkt ab, dass nie mehr Strom als erlaubt aus dem Netz gezogen wird. Dieses Bauteil hilft zudem bei der Nutzung des Stroms einer vorhandenen PV-Anlage für das Schnellladen und unterstützt im Rückspeisebetrieb bei der Verbrauchsoptimierung am Standort.
Premium-Ladesäulen
Der Endkunde bekommt von der Technik im Hintergrund nichts mit. Für ihn steht der immer gleiche Anlaufpunkt bereit: Die Ladesäulen sind das Bindeglied zum Fahrer eines Elektroautos. Da die Ingenieure alles aus der Ladesäule herausgenommen und in Flexboxen verpackt haben, was vor Ort nicht zwingend notwendig ist, konnte eine schlanke Optik verwirklicht werden.
Die kranartige Form der Säulen kommt nicht von ungefähr: Das hoch geführte flüssigkeitsgekühlte Ladekabel erreicht die Ladedose jedes Elektrofahrzeugs. Denn schließlich sollen E-Mobile aller Hersteller an diesen Säulen tanken können. Ein großzügiges 10-Zoll-Touchdisplay stellt viele Möglichkeiten für die Interaktion mit dem Kunden bereit. Insgesamt soll dieses sehr durchdacht gestaltete Konzept dazu beitragen, dass der Kunde den Ladevorgang als unkompliziert und angenehm empfindet.
Passender Strom für jedes E-Modell
Durch die jeweilige Ladekontrolle in der Säule wird automatisch die Kommunikation zum Fahrzeug aufgebaut. Sie gleicht sofort zu Beginn des Ladevorgangs die Anforderungen des Fahrzeuges mit den Möglichkeiten der Ladestation ab. Ist ein Fahrzeug für die von Porsche entwickelte 800-Volt-Technik eingerichtet, kann es mit hoher Leistung geladen werden.
Der Ladepunkt versorgt aber auch Fahrzeuge, die nur für geringere Ladeleistungen ausgelegt sind. Auch sie erhalten den für sie passenden Strom. Technisch setzt Porsche auf das Combined Charging System (CCS1/CCS2) als europaweiten Standard. Dieser ist angepasst an das höhere Spannungsniveau und auf die höheren Ströme des Ladeparks. Mit geringen Änderungen der Ladekontrolle können aber auch weitere Ladestandards wie CHAdeMO oder GB/T umgesetzt werden, so dass sich damit weitere Fahrzeuge selbst in Regionen wie Japan und China bedienen lassen.
Betriebssicher – jetzt und in Zukunft
Neben der aktuell hohen Flexibilität für Betreiber und Kunden wurde auch darauf geachtet, für künftige Anforderungen entwicklungsfähig zu bleiben. Deshalb haben die Porsche Engineering-Kollegen aus Prag die Software für die Steuerung des Ladeparks, des Ladevorgangs und die Serveranbindung selbst entwickelt. Dadurch ist der Ladepark nicht nur Smart Grid-fähig, kann also aktiv mit der Infrastruktur kommunizieren, sondern lässt sich dank der eingebauten, zentralen Intelligenz auch dann noch betreiben, wenn beispielsweise die Back-End-Kommunikation zur elektronischen Kasse des Betreibers ausfällt. Der Ladepunkt bleibt auch in einer solchen Situation für den Kunden verfügbar.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1326200/1326202/original.jpg)
„Autonomes Fahren und Porsche passen sehr wohl zusammen“
(ID:45498657)



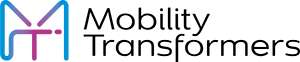
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/7c/237cae1e646212a6506b57a39f63fdfc/0129206638v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/47/58/4758e91dc6a4ca898787cea68a704d78/0129083411v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e2/a2/e2a20c0d8c4b83ed3a1a97da395aff57/0129071657v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/51/ec51ca24a6f5bc18eba4b4365da66db4/0129054296v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/58/4a/584a031cfbf34053401421566f8c30b5/0129264874v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a7/e7/a7e708d65966f5a1af4efc5fbf2d74a0/0129255976v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0d/dc/0ddc80ddfd317c017122bc15ec2fc109/0129237953v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f2/de/f2de4f25727ac9ec081ddd044610ba90/0129237486v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/df/72/df72214a59dcab1167187c1dc50ecca2/0129233467v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/1d/031dfeb087371f6707f30b46b355e4c0/0129205858v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/65/6d/656d1dfbd8ed0a8006f645c88bf7b35a/0129137154v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/93/e7/93e7c549c8a719b3405298b13211a8d3/0129121973v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/68/c368a3ad72ac970809451c311e05a07b/0127817359v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/4f/6a4f63cfca5e01026d25edd19b5302c5/0127761368v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/42/86/4286fd057b5413102fbac1758d2dc55f/0127713923v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/49/36496a26b0c295de6d9a36d66ea7571a/0125402418v3.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0e/60/0e6054de5c33446a03daf6c527008ad9/0123173974v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/21/e4/21e4eebf7ef54651a7aea5410af8251e/0126157872v2.jpeg)