„Auch der E-Antrieb bleibt für BMW ein Differenzierungsmerkmal“
Im Interview erläutert Stefan Juraschek, Leiter Entwicklung Electric-Powertrain bei der BMW Group, warum eine eigene Zellenproduktion gegenwärtig keinen Sinn macht, welche Differenzierungsmöglichkeiten der E-Motor bietet und welche Wege der Münchner Autobauer beim Recycling geht.
Anbieter zum Thema

Herr Juraschek, hat BMW die Elektromobilität verschlafen?
Stefan Juraschek: Nein, definitiv nicht. Mit BMW i war die BMW Group in einer Pionier-Rolle. Heute sind wir der Premium-Hersteller mit dem breitesten Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Bis 2025 soll die Zahl auf mindestens dreizehn Plug-in-Hybrid-Modelle steigen. Zusammen mit dem breiter werdenden Angebot an rein elektrischen Fahrzeugen, deren elektrische Reichweite bereits im kommenden Jahr signifikant steigt, wird das Angebot dann mindestens 25 elektrifizierte Modelle umfassen.
Ist die BMW Group gerüstet, wenn die E-Mobilität in Zukunft noch stärker an Fahrt aufnimmt?
Stefan Juraschek: Derzeit entwickelt die BMW Group die bereits fünfte Generation ihrer Elektroantriebe. Diese wird bereits 2020 im BMW iX3 zum Einsatz kommen. Ein entscheidender Vorteil dieser 5. Generation ist, dass die E-Maschine zusammen mit Getriebe und Leistungselektronik eine neue, hochintegrierte E-Antriebskomponente bildet. Diese sehr kompakte Einheit beansprucht deutlich weniger Platz als die drei einzelnen Komponenten der Vorgängergenerationen. Zudem ist sie dank ihres modularen Aufbaus skalierbar und kann an unterschiedlichste Bauräume und Leistungsstufen angepasst werden. Zeitgleich mit den neuen E-Antriebskomponenten wird die BMW Group die nächste Batteriezellgeneration in den neuen, skalierbaren und noch leistungsfähigeren Fahrzeugbatterien in Serie bringen. Dank der modularen Baukastenlösung können diese flexibel in der jeweiligen Fahrzeugarchitektur eingesetzt werden. Ergänzt wird das Portfolio durch eine ebenfalls hochintegrierte Lader/DC/DC Einheit.
Wie kann man sich das vorstellen?
Stefan Juraschek: Wir werden auf der einen Seite flexible Fahrzeugarchitekturen haben und auf der anderen Seite die skalierbaren und modularen Baukästen für die E-Antriebe. Das erhöht unsere Flexibilität nachhaltig. Künftig können wir kurzfristig entscheiden, welche Modelle in welchem Mix wir mit einem voll elektrischen Antrieb, Plug-in-Hybrid oder einem hocheffizienten Verbrennungsmotor ausstatten. So können wir jedes Modell je nach Marktnachfrage auch teil- oder voll-elektrifizieren. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, zukünftig reine Batteriefahrzeuge in die Breite zu bringen.
Wenn Sie Batteriefahrzeuge in die Breite bringen, sehen Sie da nicht ein Risiko, gar nicht die nötigen Mengen an Rohstoffen zu bekommen?
Stefan Juraschek: Ein Versorgungsrisiko sehen wir auch bei steigender Nachfrage nach Batteriezellen nicht. Über langfristige Verträge haben meine Kollegen im Einkaufsressort für uns die Versorgung gesichert. Zudem haben wir in-house Kompetenzen zur Batteriezelle, die wir in Kooperationsprojekten mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette aufgebaut haben. Die nutzen wir zur Sicherung des Technologiezugangs und der Versorgung. Gleichzeitig versuchen wir den Anteil an kritischen Rohstoffen schrittweise zu reduzieren. So ist beispielsweise die signifikante Reduzierung des Kobalt-Anteils in der Batteriezelle ein wesentliches Ziel unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Ein anderes Beispiel ist in unserem E-Antriebsstrang der fünften Generation die E-Maschine, die ohne seltene Erden auskommt.
Lassen Sie uns noch kurz bei der Batteriezelle bleiben. Mehrere Konkurrenten von Ihnen setzen Pouch-Zellen ein. Warum verwenden Sie prismatische Zellen?
Stefan Juraschek: Die prismatische Anordnung erlaubt eine bessere Industrialisierungsfähigkeit der Batteriemodule durch die Steigerung des Automatisierungsgrads bei der Modulmontage. Darüber hinaus erreichen wir eine bessere Integration von Sicherheitssystemen wie zum Beispiel eines Sicherheitsventils zur Abschaltung der Zelle bei einem Kurzschluss. Außerdem können wir dadurch eine höhere Packungsdichte und somit eine optimale Nutzung des fahrzeugspezifischen Bauraums ermöglichen.
Zellhersteller aus China, Japan und Korea investieren seit Jahren enorme Summen in die Zellentwicklung und künftige Batterietechnologien. Können Sie deren Vorsprung – technologisch, aber auch wirtschaftlich – überhaupt noch einholen?
Stefan Juraschek: Bei der Batterietechnologie können wir keinen Vorsprung von Wettbewerbern gegenüber uns erkennen. In der Summe der Eigenschaften ist unsere Batterietechnologie je nach Betrachtungsweise auf Augenhöhe oder dem Wettbewerb voraus. Wir beschäftigen uns bereits seit 2008 mit der Batteriezelle und sind unter anderem mit einem internationalen Netzwerk an Kooperationen gut aufgestellt. Für uns gilt, dass wir unsere Inhouse-Kompetenz weiter ausbauen und die Batteriezelltechnologie weiter vorantreiben. Zudem befähigt uns der Aufbau von Batteriezell-Prototypen und Kleinserien, die Produktionsprozesse vollständig zu analysieren und eine sogenannte „Build-to-Print Kompetenz“ aufzubauen. Damit können wir Systemlieferanten von der Auswahl des Materials bis hin zur Zellproduktion exakt nach BMW Group Vorgaben beauftragen.
Warum produzieren Sie die Batteriezellen dann nicht selbst?
Stefan Juraschek: Die BMW Group sieht derzeit und auch für die kommenden Jahre keinen wettbewerbsdifferenzierenden Vorteil in der Produktion der Zelle. Dort wo wir einen solchen Vorteil sehen, produziert unsere konzerneigene E-Komponenten-Fertigung die Komponenten auch selbst – wie zum Beispiel den elektrischen Antriebsstrang. So fertigen wir selbst aus den angelieferten Batterie-Zellen die Module und komplettieren diese zu Hochvoltspeichern.
Macht das wirklich Sinn?
Stefan Juraschek: Als die Entwicklung des BMW i3 konkreter wurde, gab es keine E-Maschine auf dem Markt die alle unsere Kriterien erfüllt hätte. Und auch heute wollen wir hinsichtlich der wesentlichen Performance-Eigenschaften genauso wenige Kompromisse machen, wie bei Bauraum, Leistung und Gewicht. Antriebe waren für die BMW Group schon immer wettbewerbsdifferenzierend. Bei den E-Antrieben ist dies nicht anders.
Kann der Kunde da wirklich einen Unterschied erkennen?
Stefan Juraschek: Der Kunde wird nicht jede Eigenschaft der E-Maschine zuordnen können, aber im direkten Vergleich ist der Unterschied doch relevant. Am deutlichsten merkt der Kunde wahrscheinlich, bis zu welcher Geschwindigkeit der Motor seine Leistungsfähigkeit aufrechterhält. Indirekt merkt er, dass die Reichweite schneller sinkt, wenn der Wirkungsgrad der E-Maschine schlechter ist.
Die BMW Group arbeitet mit Northvolt und Umicore zusammen. Warum eigentlich?
Stefan Juraschek: Das Ziel ist der Aufbau eines geschlossenen Lebenszyklus für nachhaltige Batteriezellen in Europa. Das beginnt mit einem Zelldesign, das Recycling ermöglicht und setzt sich fort über einen Produktionsprozess, bei dem überwiegend erneuerbare Energien verwendet werden. Zuerst sollten die Batteriezellen möglichst lange im Fahrzeug ihren Dienst tun. Wenn Sie dort nicht mehr genutzt werden, kommen sie möglicherweise in einem stationären Speicher zum Einsatz. Zum Schluss werden die Batterie-Zellen dann recycelt und die Rohmaterialien wiederverwendet. So schließt sich dann der Kreislauf.
Und welcher der drei Partner hat dabei welche Aufgabe?
Stefan Juraschek: Die BMW Group hat den Schwerpunkt bei der Zell-Entwicklung, Northvolt baut eine Zellfertigung in Schweden auf und Umicore ist der Spezialist für Materialkreislauf und Recycling.
BMW hatte bisher auch schon Entwicklungen zum Recycling der Materialien gemacht. Was entsteht jetzt gemeinsam mit Umicore?
Stefan Juraschek: In der Zusammenarbeit mit Umicore geht es um eine recyclinggerechte Zell- und Batterietechnologie, die sich über einen nachhaltigen Produktionsprozess fortsetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden ja große Mengen zum Recyceln zurückgeführt werden. Bevor es soweit ist, sehe ich aber noch eine lange Phase der Primär-Nutzung in den Fahrzeugen und die Nutzung in stationären Second-Life-Speichern.
Wie sieht diese Nutzung konkret aus?
Stefan Juraschek: Für die BMW Group ist die Verwendung gebrauchter Batterien als stationäre Stromspeicher ein konsequenter Schritt zu ganzheitlicher Nachhaltigkeit. Im Kontext der Energiewende wird der Einsatz stationärer Stromspeicher enorm an Bedeutung gewinnen. So kann ein Stationärspeicher in Zeiten eines Überangebots an Strom aus erneuerbaren Energien, Strom aufnehmen. In Zeiten eines zu geringen Stromangebots kann der Speicher wiederum Strom beisteuern. Eine solche Netzstabilisierung durch den Einsatz gebrauchter Batterien aus BMW i3- und MINI E- Prototypen haben wir bereits erfolgreich in Entwicklungskooperationen zum Beispiel mit Vattenfall und Bosch oder NextTera umgesetzt. Die Speicherfarm im BMW Group Werk Leipzig mit 700 BMW i3 Batterien beispielsweise ermöglicht es, nach dem Einsatz im Fahrzeug in einem zweiten Lebenszyklus in einem nachhaltigen energiewirtschaftlichen Geschäftsmodell profitabel zu nutzen.
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1502300/1502340/original.jpg)
Wie aus Elektrobus-Batterien stationäre Solarenergiespeicher entstehen
(ID:45672320)



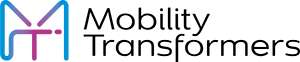
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ca/a3/caa37eede193f8bdb07874630439cb1b/0129344206v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/de/7e/de7e6c30ae3fdb02c5f21a0d82dd83e1/0129332110v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/eb/2a/eb2ae52fed872f72945a82e20102a44f/0129267589v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/7c/237cae1e646212a6506b57a39f63fdfc/0129206638v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/0e/d90e2d8e78a0a0bf2c5df2ef8eb583fe/0129353500v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/73/5d/735dc4a0e2e4acbe3623167803d31fc4/0129349252v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/37/ec/37ec252fae2b92c42d9e9ab43a5d166c/0129333782v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/45/14456d258fce7735203a31ac24e17e84/0129325747v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/0c/4d0c72f38b836539af66d2efcdaee1ac/0129309231v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/df/72/df72214a59dcab1167187c1dc50ecca2/0129233467v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/03/1d/031dfeb087371f6707f30b46b355e4c0/0129205858v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c3/68/c368a3ad72ac970809451c311e05a07b/0127817359v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/4f/6a4f63cfca5e01026d25edd19b5302c5/0127761368v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/42/86/4286fd057b5413102fbac1758d2dc55f/0127713923v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/49/36496a26b0c295de6d9a36d66ea7571a/0125402418v3.jpeg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c9/46/c94684241d8ef9adc81f74b4806483ba/0122949653v4.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/83/ec83056378fd244e4f40569845218777/0125962728v2.jpeg)